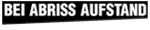„Empörung“ ist jener Schlüsselbegriff des Vertrags, der in 500 Jahren nichts von seiner Aussagekraft verloren hat. In der Landesgeschichte verwurzelt, lässt er sich nicht zuletzt auf die Massenproteste gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 übertragen. Deshalb beenden wir unseren Ausstellungsstreifzug durch die Geschichte mit einem Ausblick auf Stuttgart 21 und die Empörung, die damit einhergeht. Denn vielen stellt sich in der Tat die Frage, was unsere Verfassungsrechte noch wert sind, wenn Prestigevorhaben wie Stuttgart 21 von den Initiatoren nach Belieben schöngeredet und -gerechnet werden können und selbst die Bahnverantwortlichen längst in Betracht gezogen haben, dass die ausufernden Kosten und der vermeintliche Nutzen in keiner vernünftigen Relation mehr zueinander stehen. Was ist von Parlamentariern oder Regierungsmitgliedern zu halten, die sich als Handlanger der Lobbyisten betätigen, ohne ihrer Kontrollfunktion angesichts der ominösen Planungen und der völlig aus dem Ruder laufenden Kosten ausreichend nachzukommen. Die immer teurer gewordenen Beteuerungen von Politikern und Wirtschaftsbossen haben sich als haltlos erwiesen. Kritiker, die auf die unübersehbaren ökonomischen und ökologischen Risiken aufmerksam machen, müssen hinnehmen, dass sie als Verhinderer von Standortvorteilen und Wachstumschancen hingestellt und als ewig gestrige Bedenkenträger, die leichtfertig die Zukunftsaussichten Baden-Württembergs aufs Spiel setzen, diffamiert werden.
Überregional – ja international – wahrgenommen wurde Stuttgart 21 weder aufgrund eines herausragenden verkehrstechnischen Konzepts, noch wegen einer genialen architektonischen Lösung, sondern in Folge der stichhaltigen Einwände gegen die Realisierung eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs mit reduzierter Kapazität. Stuttgart 21 ist nicht zum Synonym für Innovation und Fortschritt geworden, sondern für die Empörung breiter Volksschichten, deren friedlich vorgetragener Widerstand – wie zu Herzog Ulrichs Zeiten – von der Staatsgewalt mit drakonischen Maßnahmen unterbunden wurde. Das Aufbegehren einer Bevölkerung, die sich von der Hybris parteiischer Machtcliquen übergangen fühlte und gegen deren rabiaten Durchsetzungswillen antrat, trug immerhin dazu bei, dass einer fragwürdigen Parteienführung das Misstrauen ausgesprochen und ihre Herrschaft in Land und Stadt beendet wurde. Angesichts der dubiosen Argumente von Investoren, Interessenverbänden, Mediatoren und jenen Politikern, welche die unsäglichen Einsätze von Polizei und Verfassungsschutz zu verantworten haben, sieht sich eine mündige Bürgerschaft zur Empörung herausgefordert.
In: Götz Adriani, Andreas Schmauder: 1514. Macht – Gewalt – Freiheit: Der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchs, Ausstellungskatalog, Tübingen 2014