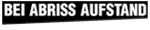Rede von Clara Tempel, Robin Wood, Aktivenunterstützung, auf der 778. Montagsdemo am 20.10.2025
Hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung,
ich bin Clara, ich bin Aktivistin, Autorin und Protestforscherin und lebe in Flensburg. Ich war in meinem Leben noch nicht oft in Stuttgart, und trotzdem fühle ich mich auf eine merkwürdige Weise mit diesem Ort des Widerstands verbunden.
Ich bin im Wendland aufgewachsen – jedes Jahr wieder sind dort Atommülltransporte ins Zwischenlager nach Gorleben gefahren. Meine Welt war von Anfang an gefärbt vom Widerstand gegen die Castortransporte. Die Anti-Atom-Sonne hat für mich geschienen, vor allem im November, wenn tausende Aktivist*innen und Polizist*innen den sonst so leeren Landkreis geflutet haben. Es war Ausnahmezustand. Neben meinem Geburtstag und den Sommerferien war das die schönste Zeit des Jahres für mich. Mit 12 Jahren durfte ich zum ersten Mal bei einer Castorblockade mit dabei sein. Das Gefühl der Gemeinschaft und der Wirksamkeit werde ich nie vergessen.
Aber es ging nicht nur um dieses singuläre Ereignis, das fast jedes Jahr verlässlich wiedergekommen ist. Ziviler Ungehorsam, Selbstorganisation und politische Ermächtigung waren seit meiner frühesten Kindheit vertraute Bestandteile meines Alltags. Ich durfte in einer Familie aufwachsen, in der solche Themen am Abendbrottisch besprochen wurden. Meine Großeltern haben in den 1960er-Jahren gemeinsam mit anderen den Ostermarsch nach Deutschland gebracht und den ersten deutschen Einzeldruck von Henry David Thoreaus „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ veröffentlicht. Meine Eltern haben große Teile ihrer Zeit in die Organisation von Aktionen zivilen Ungehorsams gegen die Castortransporte und anderes Unrecht gesteckt. Und ich war eingebettet in ein Umfeld von vielen Menschen, die durch ihre politische Arbeit verbunden waren.
Es gibt eine Erinnerung, die ich am allermeisten mit Stuttgart 21 verbinde: 2011 haben sich Menschen von X-tausendmalquer – der Gruppe meiner Eltern, die sonst gewaltfreie Sitzblockaden gegen die Castortransporte organisiert hat – den Protesten in Stuttgart angeschlossen. Sie sind hierher gefahren und haben gemeinsam mit Menschen vor Ort eine Sitzblockade gemacht, sie hieß „Aus!sitzen“. Ich war nicht dabei, ich musste ausnahmsweise auch mal zur Schule gehen. Aber im Rahmen der Zusammenarbeit von Stuttgarter Aktivist*innen und Anti-Atom-Bewegten wurden im Wendland neue Schilder gedruckt. Sie sahen aus wie ein Ortsschild, da drauf stand durchgestrichen „Gorleben21“ – den Protestschildern aus Stuttgart nachempfunden. Für mich war das schon damals ein Symbol dafür, was entstehen kann, wenn unterschiedliche emanzipatorische Bewegungen zusammenarbeiten. Dass es eben nicht darum geht, nur im Wendland oder in Stuttgart das eigene Süppchen zu kochen, sondern voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und irgendwann zu gewinnen.
Das mit dem Gewinnen hat in der Anti-Atom-Bewegung zum Glück sehr gut funktioniert. Der Atomausstieg ist erreicht. Er ist ja leider immer noch nicht ganz vollständig, denn es laufen immer noch Atomanlagen in Deutschland, aber dass alle deutschen Atomkraftwerke vom Netz sind, ist ein riesiger Erfolg. Der Erfolg einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, die jahrzehntelang auf Gefahren hingewiesen, die öffentliche Meinung verschoben, Alternativen aufgebaut und Widerstand organisiert hat – und es schließlich geschafft hat, das Window of Opportunity, das Gelegenheitsfenster des Super-GAUS von Fukushima zu nutzen und darauf hinzuwirken, dass 2011 endlich der Atomausstieg beschlossen wurde. Das ging nur mit sehr langem Atem.
Und genau den zeigt ihr hier ja auch. Das ist heute die 778. Montagsdemo, das ist eine unvorstellbar große Zahl, und ich bin sehr beeindruckt davon. Das allein ist schon ein Erfolg. Und gleichzeitig weiß ich, dass dieses Durchhalten nicht immer einfach ist. Mal bleiben die Leute weg, mal ist das Wetter schlecht, mal hinterfragt man, was das alles überhaupt bringt, mal zerstreitet man sich über große oder kleine Unstimmigkeiten. Diese Aufs und Abs, das weiß ich sowohl als Aktivistin als auch als Protestforscherin, gehören dazu. Sich immer wieder durchschütteln lassen, immer wieder auch kritisch auf uns selbst und unsere Aktionsformen schauen, immer wieder um das ringen, was uns wichtig ist und sich aneinander reiben. Es gibt ein Lied von „Arbeitstitel Tortenschlacht“, das geht so: „Reibung erzeugt Wärme und wir leben in einer bitterkalten Zeit, dass wir uns reiben, zeigt: wir sind zum Erfrieren noch nicht bereit.“ Und dann wieder zusammenwachsen, zusammen wachsen, uns auf das besinnen, was uns gemeinsam ist, unser Ziel nicht aus dem Blick verlieren, bei all unserem Unmut nicht den Mut vergessen und immer wieder weitermachen. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wo es hingeht, wie das ausgeht, wie das überhaupt alles geht.
Denn die gesellschaftliche und politische Situation, in der wir uns gerade befinden, ist so brenzlig wie lange nicht mehr. Während wir in den letzten Jahrzehnten emanzipatorische Räume ausweiten konnten, unseren Anliegen immer mehr Platz, marginalisierten Menschen immer mehr Rechte, zivilgesellschaftlichen Initiativen immer mehr Spielraum und sozial-ökologischen Forderungen immer mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit verschaffen konnten, schrumpfen nun diese Räume wieder. So weh das auch tut: Vielleicht geht es gerade gar nicht darum, neue Ziele zu erreichen, sondern darum, Etappenziele zu verteidigen. Standhaft bleiben – in einer Zeit, in der der Wind immer stärker wird und gleichzeitig beweglich bleiben, denn wir alle wissen bestimmt, dass ein Baum viel stabiler ist, wenn er sich im Wind bewegen kann.
Lasst es uns gegenseitig erlauben, Zweifel zu haben, auch mal hoffnungslos zu sein, zu trauern um alles, was schon verloren ist. Ich glaube, nur dann können wir auch wieder gemeinsam losgehen. Unsere Angst Huckepack nehmen und sie an einen Ort tragen, an dem sie sich in Mut verwandeln kann.
Und sowieso: Wenn wir über Erfolge reden, dann geht es ja nicht nur um die großen, sichtbaren Erfolge. Sondern auch um die ganz kleinen, vielleicht manchmal unsichtbaren. Um all die Selbstwirksamkeit und die Gemeinschaft, die wir erleben, wenn wir miteinander aktiv sind. Egal wie. Egal, ob wir einmal pro Woche zur Montagsdemonstration gehen, ob wir eine Sitzblockade machen, ob wir Unterschriften für ein Bürger*innenbegehren sammeln, ob wir Gespräche mit der Verwaltung führen, ob wir eine Kunstaktion planen, ob wir ein Baumhaus bauen oder ob wir mit unserer Sorgearbeit im Hintergrund ermöglichen, dass andere aktiv sein können. Indem wir gemeinsam an einer anderen Welt bauen, können wir sie schon im Kleinen vorwegnehmen. Manchmal blitzt sie auf, zwischen Regenschirmen und Gewitterwolken, zwischen Baustellenlärm und Bahnhofstrubel, zwischen Lohnarbeit und Schreckensnachrichten und Überforderung. Wenn wir uns organisieren und in unserer politischen Arbeit füreinander da sind, dann können wir vielleicht auch innerhalb dieser kippenden Welt Orte der Geborgenheit schaffen.
Ich würde euch gerne einladen, kurz die Augen zuzumachen und darüber nachzudenken, wann ihr euch geborgen fühlt.
Geborgenheit und Politik, das mag vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich wirken. Doch ich glaube, es ist wertvoll, diese beiden Dinge zusammenzudenken. Denn gerade in der derzeitigen politischen Situation, mit all den sozial-ökologischen Krisen, ist es doch noch viel wichtiger, dass wir uns aufgehoben und zuhause fühlen können, oder? Deshalb habe ich ein Buch geschrieben, in dem ich versucht habe, eine Handvoll Antworten auf die Frage zu finden, wie wir unsere politische Arbeit zu einem Raum der Geborgenheit für möglichst viele Menschen machen können. Und wie wir es schaffen, nicht nur in unseren kleinen Grüppchen gut aufeinander aufzupassen, sondern diese Geborgenheit auch im Großen weiterzudenken. Denn unsere Gruppen so zu gestalten, dass es für uns – die wir schon immer da waren oder die es sowieso in vielen Bereichen eher leicht haben – warm und gemütlich ist, kann nur der erste Schritt sein. Es ist unabdinglich, auch darüber nachzudenken, wie wir anschlussfähiger für mehr Menschen werden, wie wir auch denen ein politisches Zuhause sein können, die andere Geschichten mit sich tragen, als wir es tun. Das Buch heißt: „Politische Geborgenheit: Vorankommen und Ankommen in Sozialen Bewegungen“. Wie können wir in unseren aktivistischen Gruppen ankommen, uns sicher und aufgehoben fühlen und trotzdem mit unseren Bewegungen vorankommen und die Verhältnisse zum Tanzen bringen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es nachher bei meiner Lesung, zu der ihr herzlich eingeladen seid.
Es ist einfach, angesichts der aktuellen Weltsituation gerade die Hoffnung zu verlieren. Mir passiert das auch ungefähr vier Mal pro Tag. Und es ist so vieles schon verloren. Aber das heißt nicht, dass wir nichts mehr gewinnen können. Lasst uns lieber irgendwo anfangen, irgendwo weitermachen, immer wieder neu bewerten, was es gerade braucht und uns andere Menschen suchen, die genauso ratlos wie wir genauso unverblümt einfach mal machen. Einer der Lieblingssätze meines Vaters, von dem ich so viel lernen durfte, war dieser hier: „Wenn sich die scheinbar Ohnmächtigen zusammenschließen und sich wehren, haben es die scheinbar Mächtigen unendlich schwer, ihre Pläne durchzusetzen.“
Vielen Dank!