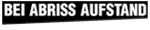Rede von Uli Stübler, Parkschützer, auf der 487. Montagsdemo am 28.10.2019
Hallo,
nochmals zum 26.10.2009 – erste Montagsdemo gegen S21.
Soweit alles klar. Tatsächlich? An diesem Tag war nämlich noch etwas. Leute, Zufälle gibts, die können gar keine Zufälle sein! Ich bitte euch um Aufmerksamkeit für etwas namens A H1N1.
Zu den Fakten: A H1N1 ist ein Subtyp dessen, was man umgangssprachlich Schweinegrippe nennt. Sie wurde möglicherweise durch einen Übergang vom Schwein auf den Menschen verursacht. Im Verlauf des Jahres 2009 war eine rasanten Ausbreitung zu verzeichnen.
Am 12. Oktober – genau zwei Wochen vor der ersten Montagsdemo – hat die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts eine Impfempfehlung für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, für chronisch Kranke und Schwangere ausgesprochen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass z.B. über die Hände auch ganz andere Berufsgruppen gefährdet werdet können.
Zur Vorgeschichte: In der Zeit gab es eine auffällige Häufung von Handschlägen.
Ihr kennt diese Herren, ....
... wir alle sehen hier Beschäftigte der Bahn, des Landes und der Industrie, der Wohlfahrtspflege eben – und möglicherweise auch chronisch Kranke, die mit – aus innerer Erregung und wegen verschüttetem Sekt – feuchten Händen einen albernen Pseudo-Startknopf drücken. Gut vorstellbar, dass davon gelegentlich auch eine Hand die andere wäscht. weiterlesen